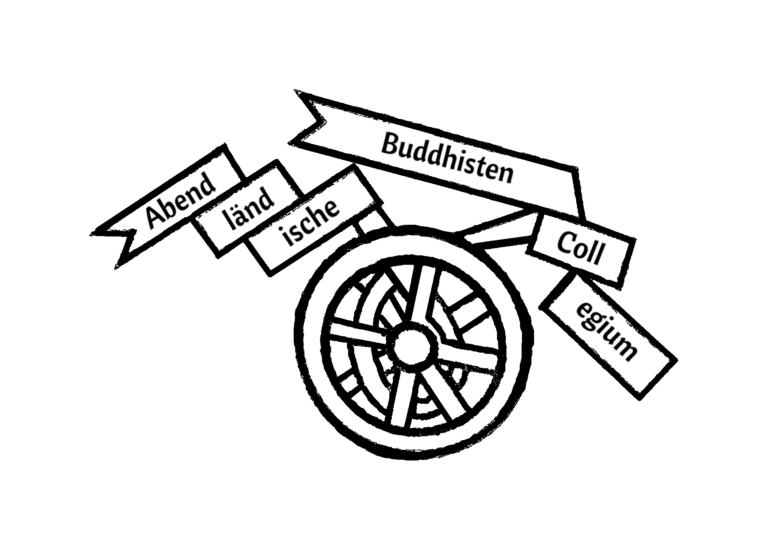Die heilige Schrift der Buddhisten ist das Tri-Pitaka („Drei-Korb“), das aus drei Lehrkörben besteht:
dem Korb mit Buddhas Lehrgesprächen (Sutta-Pitaka),
dem Korb der Disziplin für den Mönchsstand (Vinaya-Pitaka),
und dem Korb der Metaphysik (Abhidhamma-Pitaka),
der von Existenzen auf 31 Ebenen (Dimensionen) berichtet und sehr kompliziert zu verstehen ist.
Man bedenke: Die Monotheisten kennen lediglich drei Welten – Himmel, Erde und Hölle – mit nur einem Gott, einem einzigen kurzen Leben und ewiger Himmelsfreude oder ewiger Höllenpein, sofern sie ihrem ausgrenzenden, eifersüchtigen Sologott allein huldigen.
Totenreich und Meditation
Das tibetische Totenbuch berichtet ausführlich über die drei Ebenen des Totenreichs Yama-Loka.
Die Urbuddhisten (Theravāda) versammelten sich auf Totenplätzen – nicht wie heutige „Gruftis“ (Gothic?), sondern um in dieser Atmosphäre tiefere Einblicke durch Meditation zu erreichen.
Und das ist ihnen auch gründlich gelungen – der Buddhismus vermag Diesseits und Jenseits genau zu erklären.
Viele Welten – viele Gottheiten
Im Buddhismus gibt es real erlebte viele Welten, viele Gottheiten, die sich im ständigen Wandel befinden: vergehen und sich wieder erneuern.
Mitten hinein sind die vielen Lebewesen gesetzt, die in langen Ketten der Wiedergeburten Gelegenheit haben, sich zu den höchsten Welten hin zu entwickeln.
(Siehe unseren Artikel: „Entstehung der Religionen“, unter Legende Nr. 7 vom Dezember 2022, der die Entwicklung der unterschiedlichen Gottheiten erklärt.)
Die 31 Daseinsebenen laut Abhidhamma
1. Kāmā-Loka (Begierde-Welt, 11 Ebenen)
Hier reinkarnieren die Seelen von:
Astralgöttern, Agrargöttern, Elementargöttern,
Pflanzen-, Tier- und Menschenwesen
je nach ihrem Karma (Tatenwerke).
Die 11 Ebenen:
Niraya
Tiraccha
Petra-Loka
Asura-Loka
Manussa-Loka
Catum-Mahā-Rājika
Tāvatiṁsa (Himmel der 33 Devas)
Yama-Loka (Totengott-Bereich)
Tusita (Himmel der Seligen)
Nimmanarati
Paranimmita-Vasavatti
2. Rūpa-Loka (Formbereich, 16 Ebenen)
Gruppe I – Brahmā-Götter:
Brahma-Parisajja
Brahma-Purohita
Mahā-Brahmā
Gruppe II – Lichtwesen:
Parittābha
Appamānābha
Ābhassara
Gruppe III – Glanzwesen:
Paritta-Subha
Appamāna-Subha
Subha-Khiṇa
Gruppe IV – höchste Formbereiche (7 Ebenen):
Vehapphala
Asaññasattā
Aviha
Atappa
Sudassa
Sudassī
Akanittha (höchste Sphäre der Form-Welt)
3. Arūpa-Loka (Formlose Welt, 4 Ebenen)
a) Ākāsānañcāyatana (Unendlicher Raum)
b) Viññāṇañcāyatana (Unendliches Bewusstsein)
c) Ākiñcaññāyatana (Nichtsheit)
d) Nevasaññānāsaññāyatana (Weder-Wahrnehmung-noch-Nichtwahrnehmung)
Bewusstsein und Wahrnehmung
„Das Entstehen eines Bewusstseins ist vom Vorhandensein eines Objekts und der Fähigkeit, es zu erfassen, abhängig.“
Wenn sich die Selbstheit verändert, verändert sich das Bewusstsein.
Verändern sich jedoch nur die äußeren Objekte, verändert sich das Bewusstsein nicht zwingend mit.
Beispiel:
Ein trübes Auge kann nicht klar sehen – das Bewusstsein bleibt entsprechend getrübt.
Wird das Auge medizinisch behandelt, kann das Bewusstsein wieder klar erfassen.
Das Bewusstsein stützt sich also auf die Fähigkeit zur Wahrnehmung.
👉 Im Buddhismus spricht man dann vom Augen-Bewusstsein.
Jedes Sinnesorgan hat sein eigenes Bewusstsein (Ohr, Zunge, Nase, Tastsinn, Geist).
Prinzip des Vorherrschenden
Beispiel: Der Klang einer Trommel benötigt:
einen Trommler
einen Schlagstock
ein Trommelfell
Doch: Weder Trommler noch Stock erzeugen allein Klang – das Fell ist das vorherrschende Element.
Meditation und Bewusstseins-Ebenen
Wenn eine Person im Begierdebereich etwas sieht, ist zu fragen:
Gehört das Objekt dem Seh-, Hör-, Geschmacks-, Geruchs-, Tast- oder mentalen Bereich an?
Die Sinnesorgane gehören im Alltagszustand den vier Daseinsformen an: Tier, Mensch, Halbgott, Gott.
In der Meditation jedoch gehören Auge, Sehfähigkeit und Sehbewusstsein nicht mehr dem Begierdebereich an.
Unterschiede der meditativen Stufen:
1. meditative Sammlung: kann untere Ebenen sehen
2.–4. Sammlung: können höhere Ebenen erkennen, haben aber kein Sehbewusstsein im Formbereich
Formlose Bereiche haben keine sichtbaren Objekte → kein Körper-Auge kann sie wahrnehmen.
Nur das Denkvermögen (mentales Bewusstsein) kann ab der 2. Sammlung die formlosen Sphären erfassen.
18 Elemente (Dhātu)
6 Bewusstseine (für: Sehen, Hören, Riechen, Schmecken, Tasten, Denken)
6 Sinnesfähigkeiten (Auge, Ohr, Nase, Zunge, Körper, Geist)
5 Sinnesobjekte (Form, Klang, Geruch, Geschmack, Berührung)
1 mentales Objekt
→ Insgesamt: 18 Dhātus (Elemente)
Nur ein Teil der mentalen Objekte ist beständig – andere sind nichtbedingte Phänomene.
Nichtbedingte Phänomene:
Raum
Aufhören ohne Untersuchen
Aufhören mit Untersuchen
Diese sind beständig, da sie nicht durch Bedingungen entstanden sind.
Herrschende vs. nicht-herrschende Fähigkeiten
Herrschende Fähigkeiten: alle Wahrnehmungsorgane & Bewusstseine
Nicht-herrschend: Form (nichtoffenkundige Materie), Raum, geistiges Aufhören, 5 Sinnesobjekte
Schlusswort
Soweit der philosophische Einstieg in unser kleines Traktat, das sehr abstrakt und kompliziert ist und erst später verständlich wird.
Dazu benötigt man jedoch viel Raum und Zeit – um den Bogen nicht zu überspannen.