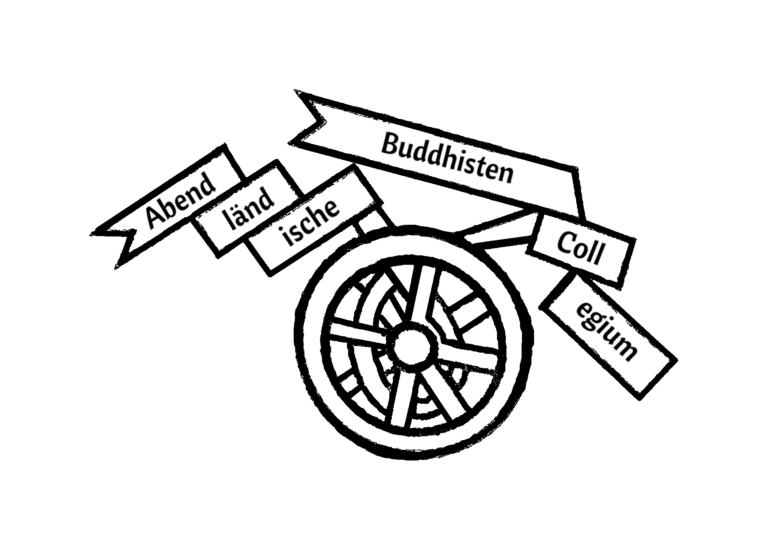Wo die Götter die Menschheit formten
Das hochzivilisierte Sumer erschien vor 5000 Jahren im Zweistromland zwischen den großen Flüssen Euphrat und Tigris, welche dort im Golf abfließen, wo einst das alte Babylonien lag. Wie die Sprache von Sumi, hat auch die von Sumer keine Verwandtschaft mit den übrigen Sprachen Europas, dem Indoeuropäischen oder dem Indo-Iranischen. Vermutlich kamen sie aus Indien – wie die Harappa-Zivilisation –, die im „fruchtbaren Halbmond des Orients“ eine neue Heimat fand.
Die Sumerer drückten Sinnbilder mit einem Griffel in weiche Tontafeln, die unter der Sonne zu Ziegeln aushärteten. Ein Stern wurde als Stern stilisiert. Später bildeten sie daraus eine Silbenschrift: etwa ein Stern und ein Berg konnte den Namen „Sternberg“ bedeuten. Und tatsächlich erfanden die Sumerer auch die Astrologie und Astronomie.
Vom Chaos zur Ordnung – Der sumerische Mythos
Der Mythos der Sumerer beschreibt den Übergang von Chaos zur kosmischen Ordnung. Es beginnt mit der Trennung der Elemente, die bis zu einem gewissen Augenblick miteinander vermischt waren. Dann setzt eine göttliche Energie ein, die die Elemente Luft, Feuer, Erde und Wasser freisetzt und ihnen ihre eigene Identität verleiht. Diesen Ursprungsgedanken übernahmen später auch die alten Ägypter.
Wie in der altisländischen Edda schildern auch die alten Keilschriften einen kosmischen Baum, der Erde und Himmel verbindet (die Urerde war zuvor ohne Atmosphäre). Die Edda beschreibt ihn als auf dem Lyfa-Berg (Lebensberg) stehenden Weltbaum. Analog dazu dachten sich die Sumerer diesen Weltbaum auf einer künstlichen Bergplattform – der Zikkurat. Diese Ziegelstein-Pyramide nannten sie „ziq-qurratu“ („hoch hinaus“).
Götter und Weltenbaum
Die vielen Säulenheiligtümer (Irminsul, Isis-Säulen, Mariensäulen) sind symbolische Darstellungen dieses Weltbaums. Im sumerischen Pantheon tragen die Götter (DIN-GIR) zahlreiche Namen, je nach Region. Göttervater ist An bzw. Anu, ein Name, der auch in der Edda (Zwergenmal, Vers 11) erwähnt wird. Er wird mit einem Malteserkreuz, Hörnerhelm und Sechsstern dargestellt. Die Erdgöttin Ki (Ninmah) ist sein Weib.
In Babylon standen später die Hebräer staunend vor den gigantischen Steinfiguren der sumerischen Götterfamilie. So wurden An und Ki zu den biblischen Gestalten JHWH (Jahwe) und Ashera (vgl. Artikel: „Israels Urreligion“).
Elemente und Götterfamilie
Ans ältester Sohn war der Sturmgott Enlil (Elil) – das Element Luft. Die Hebräer machten daraus ihren Gottestitel „El“ (arab. Allah). Anus zweiter Sohn war Enki (Ea), Gott des Wassers. Zusammen mit den Eltern An (Feuer) und Ki (Erde) bilden sie die vier Elemente. Enlil heiratete die Flurgöttin Sud (Ninlil). Ihre Kinder: u. a. Mondgöttin Nana (Sin).
Die Edda nennt Nana an der Seite Baldurs und erwähnt auch die Göttin Syn, die wir wohl als Sunna (Sonne) deuten. Eine weitere Tochter: Inanna / Ischtar (eddische Ostara, griech. Astarte, ägypt. Isis). Auch Schamasch wurde mit der Sonne gleichgesetzt.
Die Griechen setzten Enki mit ihrem Kronos (röm. Saturn) gleich. Enki erschuf laut Mythos die Menschen aus Lehm, damit sie den Göttern ihre Arbeit abnahmen – wie später die mittelalterlichen Untertanen ihren Herren. Sein Weib Ninmah wollte ihn nachahmen und erschuf aus Götterblut einen Menschen mit gesellschaftlicher Funktion – ein Hinweis auf genetische Manipulation und Ständebildung. Hier erinnert die Edda an den Dichtermet und Kwasis Blut.
Sintflut und Arche
Eine Tontafel berichtet vom Kampf der Götter gegen ein Ungeheuer, das ins Meer stürzte und dort zum Steinriesen anwuchs – wohl ein Meteorit, von den Griechen Phaeton, in der Edda Thiazzi genannt. Die Sumerer nannten sich selbst „San-gi-ga“ (Schwarzhäupter) – wie die Edda die Samen („Swarthöfdi“) nennt.
Die Götter besaßen eine Speise der Unsterblichkeit, wie auch bei Griechen und Germanen. Die sumerischen Könige galten als Halbgötter, weshalb ihre Königslisten Lebenszeiten von 28.000 bis 36.000 Jahren angaben – ein Vorbild für die biblischen Ahnenreihen.
Wie An und Ki zu Jahwe und Ashera wurden, finden sich Enki und Ninmah als Adam und Eva in der Bibel wieder. Als die Menschen ihrer Sklavenarbeit überdrüssig wurden, wollte Enlil sie durch eine Sintflut vernichten. Doch Enki (Ea) warnte seinen Freund Ziu-sudra, König von Shurruppak, und ließ ihn eine Arche bauen, in der er sich mit dem „Samen der Menschheit“ retten konnte.
In der Edda rettete sich Bergelmir mit seinem Weib vor der Sintflut in einen Mehlkasten – ein Bild für eine Kornmühle: Der Mühlstein ist der drehende Himmel, die Achse der Weltbaum.
Archäologische Belege
Archäologische Untersuchungen bestätigen eine gewaltige Überschwemmung im Zweistromland. Ziu-sudras Zikkurat war 90 Meter hoch und überragte den Wasserspiegel. Der sumerische Sintflutbericht wurde rund 1000 Jahre vor dem biblischen in Keilschrift festgehalten. Mehrere Überschwemmungen und Bodenversalzungen führten zum Niedergang Sumers.
Übrigens: Das Wort „Paradies“ stammt aus dem Persischen und bezieht sich auf den sumerischen Mythos vom gelobten Land Tilmun, wo Enki und sein Weib als einziges Paar schliefen – „bevor das Leben in Erscheinung trat“.
Kritik an kirchlichen Dogmen
Anmerkung:
Ein uns lieber Bekannter berichtete, dass er in eine fromme Familie einheiratete und sich zuvor taufen lassen musste. Er war sehr empört, als der evangelische Geistliche dabei den Satz beschwor:
„Ich treibe dich aus, du Wassergeist!“
Ich klärte ihn darüber auf, dass damit der sumerische Wassergott Enki gemeint sei – der die Menschen erschuf und später von der Kirche zum Dämon erklärt wurde.
Wenn Mythen sich über Jahrtausende hinweg durch völlig getrennte Kulturen wiederholen, spricht das nicht für Zufall – sondern für ein tiefes, kollektives Urwissen der Menschheit. Sumer ist vielleicht nicht nur die Wiege der Religion, sondern auch das Gedächtnis unseres planetarischen Ursprungs.
Frage an unsere Leser
Welche Parallelen zwischen den sumerischen Mythen und den Glaubensbildern deiner eigenen Kultur oder Religion erkennst du – und was denkst du: Zufall oder gemeinsamer Ursprung?
Weiterführende Literaturtipps
Samuel Noah Kramer – Geschichte beginnt mit Sumer
Jean Bottero – Religion im alten Mesopotamien
Georges Roux – Mesopotamien: Aufstieg der ersten Hochkultur
Edda (Übersetzung v. Felix Genzmer) – Die Lieder der älteren Edda
Giorgio de Santillana & Hertha von Dechend – Hamlet’s Mill: Ein Essay über Mythos und das Zeitverständnis alter Kulturen
Stefan Maul – Die Wahrsagekunst im alten Orient
Wichtige Hinweise zu externer Literatur
Wir freuen uns, Ihnen eine sorgfältig kuratierte Auswahl an weiterführenden Quellen präsentieren zu können, die wir als besonders hilfreich und informativ erachten. Diese Ressourcen bieten Ihnen zusätzliche Einblicke und vertiefende Informationen zu den Themen, die wir auf unserem Blog behandeln.
Unsere Empfehlungen umfassen:
- Fachartikel und wissenschaftliche Studien
- Bücher renommierter Autoren
- Websites von vertrauenswürdigen Institutionen
- Lehrvideos und Online-Kurse
Bitte beachten Sie jedoch, dass wir keinen Einfluss auf die Inhalte dieser externen Quellen haben. Die dort präsentierten Meinungen und Informationen spiegeln nicht zwangsläufig unsere eigenen Sichtweisen wider. Außerdem übernehmen wir keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Inhalte der verlinkten Quellen.
Wir hoffen, dass Sie von diesen zusätzlichen Ressourcen profitieren und wünschen Ihnen viel Erfolg bei Ihrer weiterführenden Recherche!
Vielen Dank für Ihr Verständnis.
Ihr Blog-Team